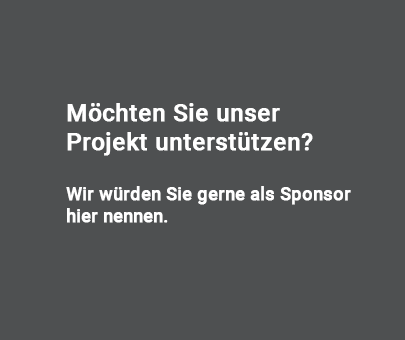Auf dem Weg in das „verwöhnte, verdorrende Europa“
Von Russland nach Deutschland: Einblicke einer jungen Spätaussiedlerin von außen nach innen

„Wow, du kannst ja richtig gut Deutsch sprechen! Ich hätte nicht gedacht, dass du aus Russland kommst“ ist meistens die Antwort, wenn ich jemandem erzähle, dass ich seit neun Jahren in Deutschland lebe. Diese Reaktion erinnert mich stets an mein Glück, gesellschaftlich integriert und finanziell gut aufgestellt zu sein. Diesen Stand zu erreichen, war aber definitiv nicht leicht.
Es ist das Jahr 2016 und ich besuche als Neunjährige eine Schule in meiner sibirischen Heimatstadt. Ich schubse meine Freundinnen und Freunde spielerisch in den Schnee und träume davon, das riesige Land zu bereisen. Ein Jahr zuvor habe ich mit meiner Familie einen Urlaub in Deutschland verbracht. Ich verstehe nicht, warum meine Eltern immer wieder fragen, wie es mir gefallen hat und ob ich mir vorstellen könnte, dass wir dort wohnen. Dann ist es so weit: Meine Eltern erzählen von der Entscheidung, nach Deutschland zu ziehen. Der Umzug steht wenige Monate bevor.
Das war der langjährige Traum meiner Eltern. Sie sahen die Chance auf eine positivere politische und wirtschaftliche Lage und auf ein besseres Leben für uns Kinder. Unser Status als Spätaussiedler verlieh Hoffnung, dass der Umzug mit all den Formalitäten und der Bürokratie einfacher sein würde. Diese Entscheidung traf im Umfeld meiner Familie nicht nur auf Bewunderung, sondern auch auf Abneigung – immerhin waren wir auf dem Weg in das „verwöhnte, verdorrende Europa“…
Im neuen Land bestanden meine Sprachkenntnisse zunächst aus Smalltalk und „Ich verstehe nur ein bisschen“ – für meine Familie war ich also keine große Hilfe. Deshalb konzentrierte ich mich darauf, so schnell wie möglich Deutsch zu lernen. Während meine Eltern Schwierigkeiten damit hatten, die ganze Familie mit Nahrung zu versorgen und ihre Abschlüsse anerkennen zu lassen, saß ich stundenlang vor einem Wörterbuch und lernte mit Tränen in den Augen Artikel auswendig. An der neuen Schule hatte ich für die Kommunikation mit Mitschülerinnen und Mitschülern nur mein gebrochenes Englisch zur Hand. Entgegen meinen Ängsten und Sorgen wurde ich herzlich empfangen und stets von Lehrkräften unterstützt. Ich kämpfte mich mühevoll durch die deutschen Zeitformen und lernte überraschend schnell, sodass ich bereits nach einem Jahr für meine Eltern wichtige Briefe und Versicherungsdokumente übersetzen konnte. In der fünften Klasse hörte ich zum ersten Mal „Wow, man hört es gar nicht raus, dass du Russin bist!“ Was mich mit unfassbarem Stolz erfüllte.
In meinem Schulalltag bemerkte ich, dass Kulturen wie unterschiedliche Welten sein können. Hier fühlten sich Freundschaften ganz anders an: vor allem der Humor und der Umgang miteinander unterscheiden sich. Ich empfand Kälte anstatt Gemeinschaftsgefühl. Wo ich mich vor unzähligen strengen Regeln fürchtete, fand ich viel weniger Disziplin als in meinem Heimatland vor. Doch selbst nachdem ich gelernt hatte, mich anzupassen, wurde ich immer noch anders als meine KlassenkameradInnen angesehen. Unter den Eltern meiner Freundinnen war ich als „die kleine Russin“ bekannt. Ich habe noch nie verstanden, warum man den Fokus so sehr auf meine Nationalität setzt.
Erst Jahre nach dem Umzug fiel mir auf, wie normalisiert Militarismus in Russland wirklich ist. Bereits ab den ersten Schuljahren wird Kindern Patriotismus und Gehorsam hautnah beigebracht, während an deutschen Schulen Eigeninitiative und kritisches Denken zählt. Auch der Lebensweg wird hier nicht streng vom System vorgegeben. Denn es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, die eigene Karriere zu gestalten – so viele, dass es einen verunsichern kann.
Ein Umzug verändert immer das Selbstbild. Viele Migranten leiden unter einer zwiegespaltenen Identität, da sie sich zu keiner Kultur vollständig zugehörig fühlen. Ich selbst betrachte meine Situation positiver, da ich zwei Kulturen in mir vereinen kann. Ich fühle mich nicht gezwungen, mich einem einzigen Land zuzuordnen, sondern kann mir jeweils die Aspekte einer Kultur „rausnehmen“, die mir gefallen. Dies trifft beispielsweise auf meine politischen Ansichten zu: Mir wurde einst gesagt, ich sei europäisch, weil ich mich am politischen Geschehen tatsächlich beteilige und im Gegensatz zu vielen anderen Russlanddeutschen keine fremdenfeindliche Einstellung vertrete. Ich fing erst an, mich wegen meiner Herkunft zu schämen, als Russland im Jahr 2022 seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begann. Auch der aktuelle Rechtsruck wirkt sich auf meine Identität aus. Es fällt immer schwerer, sich in diesem Land willkommen und sicher zu fühlen, wenn Migration die größte Diskussion in der Politik darstellt. Wenn sogar Minderheiten gegen andere Minderheiten in der Gesellschaft hetzen.
Durch den Umzug änderte sich meine Perspektive auf die Welt grundlegend. Ich wurde für vieles dankbar, was andere für selbstverständlich halten: So wie dafür, dass ich jeden Tag in einen vollen Kühlschrank greifen kann. Dass ich die Möglichkeit habe, auf Konzerte zu gehen. Dass ich mich mit Gleichgesinnten offen austauschen kann. Freiheit, Demokratie und Rechte sind Privilegien; das sollte sich jeder bewusst machen. Und auch wenn man mir die Nationalität nicht ansieht oder man keinen Akzent mehr in meinem Sprechen heraushört – mein Herkunftsland wird immer ein großer Teil von mir bleiben, der einfach nicht zu verstecken ist.
Das Foto zeigt Pauline als 9-Jährige bei einer Reise durch Chakassien (Sibirien). Sie schreibt: Dieser Sprung über den Abgrund fühlte sich ähnlich an wie unser Umzug nach Deutschland.