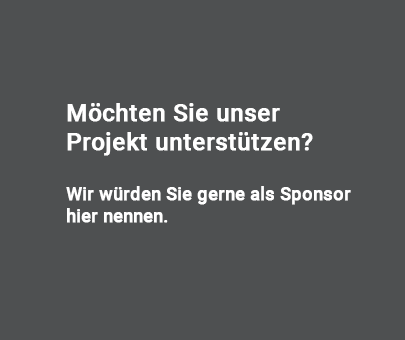Wie bekommen Jüngere mehr Gewicht bei Entscheidungen?
Wir schauen weltweit: Wie werden Jugendliche eingebunden?

Zunächst ein Vorschlag von uns, der RAVOLUTION: Die UN hat 17 Nachhaltigkeitsziele vorgegeben: von „Keine Armut“ über „Bezahlbare und saubere Energie“ bis hin zu „Partnerschaften zur Erreichung der Ziele“. Diese „SDGs“ gelten als Maßstäbe für politische Entscheidungen. Wir regen ein 18. Ziel an, einen weiteren Maßstab: „Generationengerechtigkeit“. Alle Gesetze und Regeln, die in den Staaten und auf kommunaler Ebene getroffen werden, müssen explizit auf den Prüfstand: Ist die jeweilige Entscheidung positiv für alle Altersgruppen und besonders für zukünftige Generationen?
Was tut sich, um Jugendlichen politische Partizipation zu ermöglichen?
Wahlalter senken auf 16
Bei der Europawahl 2024 durfte in Deutschland erstmals ab 16 Jahren gewählt werden. Auch in mehreren Bundesländern bei Landtagswahlen und Kommunalwahlen, aber noch nicht bei der Bundestagswahl. Das Wahlrecht ab 16 Jahren gilt bereits seit 2007 in Österreich. Auch in Malta, Griechenland und in Belgien (bei verschiedenen Wahlen mit verschiedenen Mindestalterangaben).
Bürgerräte bzw. Zufallsbürger – Deliberative Beteiligung
Deutschland: Je nach Bundesland sind BürgerrätInnen bzw. ZufallsbürgerInnen in einem Beteiligungsprozess ab 16 Jahren zulässig. In einzelnen Kommunen bereits ab 14 Jahren, gerade wenn es um Jugendthemen geht. KlimabürgerInnenräte (Frankreich u.a.) gibt es als zufallsbasierte Mini-Öffentlichkeit. Die Praxis zeigt, dass quotierte/stratifizierte Auswahl jüngere Stimmen sichtbarer macht. (Mindestquoten unter 25 Jahren).
Eltern-/Kinder-Stimmen (Proxy-Vote / Demeny Voting)
Die Idee: Eltern bekommen bei Wahlen zusätzliche Stimmen für ihre minderjährigen Kinder (z.B. 0,5 Stimme pro Elternteil). Bisher nur vorgeschlagen, nicht breit implementiert; u. a. in Japan/Neuseeland wissenschaftlich diskutiert.
Future-Proofing: Institutionen für „künftige Generationen“
Wales: Well-being of Future Generations Act (2015) + Future Generations Commissioner: Behörden müssen nachweislich langfristige Folgen prüfen und generationengerecht handeln. Deutschland: Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2021 zum Klima. Grundrechte der jungen und künftigen Generationen müssen gestärkt werden. Politik darf Lasten nicht unzumutbar in die Zukunft verschieben.
Gesetzes-Folgenprüfungen für die Jugend (Youth/Child Impact)
Deutschland: Kompetenzzentrum Jugend-Check (KomJC) prüft alle Bundes-Gesetzesvorhaben auf Auswirkungen für 12- bis 27-Jährige. Ein Projekt vom Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung. Gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das Kompetenzzentrum hat z.B. beim „Wehrdienst-Modernisierungsgesetz“ „mögliche Auswirkungen identifiziert“. Österreich: seit 2013 verpflichtender Jugend-Check in der wirkungsorientierten Folgenabschätzung. EU-weit: Child Rights Impact Assessment (CRIA) als Standardtool – u.a. von FRA/ENOC empfohlen; Norwegen verschärfte 2024 die Vorgaben.
Reservierte Jugend-Sitze / Quoten
Ruanda: 2 Sitze im Unterhaus über National Youth Council. Uganda: 5 reservierte Parlaments-Sitze für Jugend (National Youth Delegates Conference; verfassungs-/gesetzlich geregelt). Kenia: Im Senat je 1 Frau/1 Mann für Jugend reserviert; zusätzlich 12 „special interest“-Sitze.
Jugendgemeinderäte und andere Beteiligungen
In mehreren badischen Städten gibt es einen Jugendgemeinderat, dazu gehören Ettlingen und Bruchsal. In Gegenbach sind die Mitglieder auf zwei Jahre gewählt und dürfen bei der Stadtentwicklung ihre altersgerechte Sicht einbringen. Zum Beispiel bei Radwegen, Graffiti-Aktionen oder Kulturprogramm. In Rastatt gibt es die Jugenddelegation und einmal jährlich einen Jugendgipfel, bei dem die Themen und Gäste selbst bestimmt werden können. Dazu kommen Jugendfragestunden in den Gemeinderatssitzungen.
Petitionen
Im Grundgesetz (Artikel 17) ist verankert: „Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.“ Eine Altersgrenze gibt es nicht. Jugendliche können Petitionen über das Petitionsportal des Bundestags einreichen. Über verschiedene digitale Plattformen starten Jugendliche immer öfter ihr eigenes Anliegen. Laut openPetition-Statistik 2024 stammen rund 18 % der PetitionsstarterInnen aus der Altersgruppe 14 bis 24 Jahren.
Auch RAVOLUTION hat 2019 eine Petition gestartet und wollte den Klimanotstand in Rastatt erreichen. Die notwendige Stimmenanzahl wurde nicht erreicht. Auch der Gemeinderat lehnte das Ansinnen mehrheitlich ab. Aber es wurden viele Gespräche geführt – vom OB über die einzelnen Fraktionen bis hin zu ExpertInnen – und die Stadt Rastatt hat verschiedene Maßnahmen umgesetzt. Dazu zählt die Bestellung eines Klimaschutzbeauftragten und das Einsetzen eines Klimaschutzrates, in dem RAVOLUTION vertreten ist.
Demonstrationen
Auch für das Recht auf Versammlungsfreiheit gibt es ein Grundrecht: Artikel 8 im Grundgesetz. In Baden-Württemberg gibt es ein spezielles Versammlungsgesetz, das z.B. die Anmeldungen regelt. Zwar gibt es keine grundsätzliche Altersfreigabe, aber Kommunen fordern meistens eine verantwortliche Person mit Geschäftsfähigkeit, also in der Regel ab 18 Jahren.